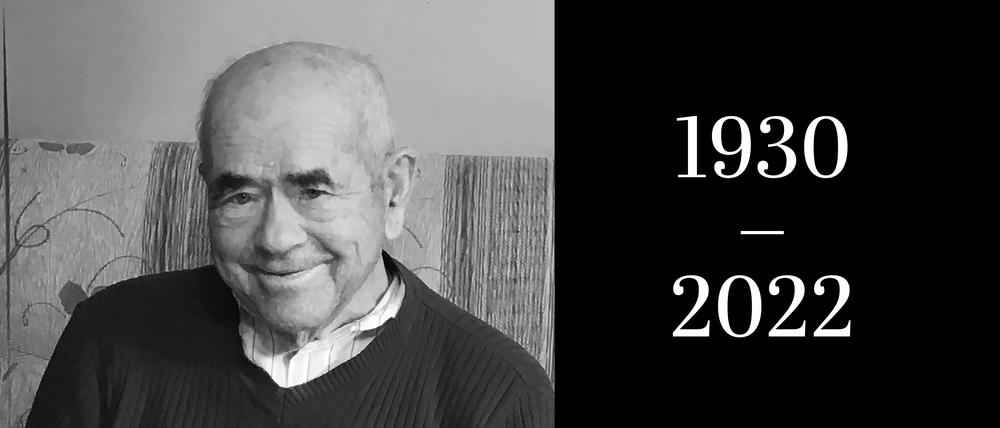
© privat
Nachruf auf Rudolf Helbig: Viele Fluchten
Er hat gern erzählt, von früher, von der Heimat. Was er nicht erzählt hat, war, was die Angst mit einem macht
Etwas Braunes, Großes und Schweres klatschte auf ihn herunter, „irgendein riesiges Stück Fleisch, eine absurd schwere Decke, ein monströser Fladen“. Es wurde feucht und dunkel, eine behagliche Wärme umschloss ihn, fast war er versucht, sich einzuschmiegen ins Wohlige. Aber er befreite sich, blutüberströmt, kroch hervor unter der zerrissenen Pferdehälfte, blickte hinüber zu seiner Mutter und seinem Bruder. Beide hatten den Fliegerangriff überlebt.
Das Pferd hätte ihren Leiterwagen in den Westen ziehen sollen, weg von den heranmarschierenden russischen Soldaten. Aber sie waren zu spät losgezogen aus Kurheim, kamen nicht weiter als bis Gnesen, mussten umdrehen, der nahenden Front entgegen.
Die Tochter Brygida erzählt davon in ihrem Buch „Kleine Himmel“, von der Flucht des Vaters, den vielen Fluchten. Er hat gern erzählt, von früher, von der Heimat, aber was er nicht erzählt hat, war, was die Angst mit einem macht, von Kindesbeinen an war sie in ihm, diese Angst, alles zu verlieren.
Sechs Jahre war er alt, als er durchs ganze Dorf rannte, um für seinen Vater eine Zigarette zu holen. Er lag im Sterben, der Vater, es war sein letzter Wunsch, eine Zigarette, und der kleine Junge war sehr stolz, den Wunsch erfüllen zu können. Der Tote lag noch einige Zeit in der warmen Stube, „damit er sich an das Nichtsein gewöhnte“ und die Hinterbliebenen den Trost der Nachbarn entgegennehmen konnten.
Rudolfs Vater war Bauer gewesen, wie alle in der Kolonie Steinfels, ein wenig Ackerland, ein wenig Gemüse im Garten, nebenher arbeitete er als Zimmermann, aber reich wurde keiner im Dorf. Da waren die Wölfe, die es aufs Vieh abgesehen hatten, und die Wildschweine, die sich über die Kartoffeln hermachten, schlimmer noch die Kartoffeldiebe, die es nach Sonnenuntergang von den Vorräten abzuhalten galt. Die durchwachten Nächte brachten dem Vater den frühen Tod, mit nur 34 Jahren war es vorbei, er verkühlte sich, spuckte Blut und Galle, legte sich nieder zum Sterben, daheim, denn das Krankenhaus war zu teuer.
Der schönste Ort auf Erden
Damals in Galizien, da lebten sie alle friedlich zusammen, Polen, Ukrainer, Juden, Bojken und Lemken siedelten hier, und eben die Nachfahren der Pfälzer, die sich Ende des 18. Jahrhunderts eine neue Heimat gesucht hatten. Die Kolonie Steinfels existiert längst nicht mehr. Aber in Rudolfs Erinnerung blieb es der schönste Ort auf Erden, mit Wasser so klar, Wäldern so grün und einer Sonne, die heller schien als anderswo.
„Was ist das für ein Leben“, fragte ihn seine Tochter viele Jahre später, „wenn dein Zahnarzt ein Schmied ist?“ - „Mir hat es aber gefallen“, beharrte er trotzig auf seinen Erinnerungen, die er so gern kulinarisch auffrischte mit Kartoffelbrötchen, Krautrouladen und Pilzsuppe. All die leckeren Speisen, die es an den Feiertagen gab, da waren die Dörfler zusammen, erinnerten sich ihrer Herkunft, sangen die Lieder, die nur ihnen gehörten. Ansonsten gab es nicht viel zu feiern und nicht viel zu essen, erst recht nicht, als der Vater tot war.
Noch auf dem Sterbebett hatte er der Frau das Versprechen abgerungen, dass sie nie einen anderen Mann heiraten dürfe, eifersüchtig war er über den Tod hinaus, und machte ihr das Leben noch schwerer, als es ohnehin schon war. Drei Jungs hatte sie auf die Welt gebracht, den Jüngsten nahm sie mit aufs Feld, die zwei Älteren band sie daheim am Tisch fest, damit sie keinen Unfug anstellen konnten. Dabei brannte Rudolf darauf, der Mutter eine Hilfe zu sein. Abends blieb er wach, schützte Haus und Hof, während die Mutter sich als Wäscherin bei den Nachbarn etwas dazuverdiente. Und die Mutter schützte ihn, wenn die Lehrer einfach drauflosdroschen, oder ihn auf die Knie zwangen, auf einen Beutel mit Erbsen, damit es so richtig weh tat.
Dann kam der Krieg, Polen wurde aufgeteilt zwischen Hitler und Stalin, Steinfels kam zur Sowjetunion, und die Steinfelser wurden umgesiedelt in den Warthegau. Die Älteren wollten erst nicht weg, „wegzugehen hieß, zu sterben, ohne die Aussicht wiedergeboren zu werden.“ Wer sollte sich noch erinnern, wenn die Gräber unter Unkraut verschwanden? Dann war alles dahin, als wäre es nur ein Traum gewesen. Rudolf ist nie zurückgekehrt an den Ort, auch im Alter nicht, was hätte er auch sehen sollen, verwilderte Gärten hätte er sehen können.
Die Mutter und der Knecht
Auf dem Weg in die neue Heimat sahen sie die vielen polnischen Gefangenen, die in andere Landesteile gekarrt wurden, mitleidig waren die Blicke, denn sie hatten sich ja immer gut verstanden mit ihren polnischen Nachbarn. Viel zu gut, dachte der Sohn, was seine Mutter anging, denn die fing wenig später in Kurheim eine Liebschaft mit dem polnischen Knecht an, der ihnen auf dem neuen Hof als Hilfskraft zugeteilt wurde. Rudolf grollte, er wusste doch um den Wunsch des Vaters, dass da nie ein anderer Mann sein durfte. Und dann kam er ins Haus, der Knecht, der so schüchtern war, anfangs, Marian Miczynski.
Rudolf kam in die Hitlerjugend, er war pfiffig und sportlich und diszipliniert, endlich konnte er zeigen, was in ihm steckte. Er schlug die Trommel, er schritt voran. Und dann war da noch diese Lehrerin, eine, die nicht prügelte, eine, die erkannte, was in ihm steckte. Rudolf sollte aufs Gymnasium, seine Lehrerin warb dafür bei der Mutter, aber die lehnte ab, brauchte Rudolf zuhause, was ihn verbitterte. Der Rottenführer hatte ihm eingeschärft, der Führer sei wichtiger als die Eltern. Hieß das für ihn, er musste melden, was er vermutete, dass da etwas war zwischen seiner Mutter und dem Knecht? Er hatte es ja gesehen mit eigenen Augen, wie der aus seiner Kammer in ihr Schlafzimmer schlich. Das musste er melden, schließlich hatte ihm der Führer persönlich die Hand geschüttelt, als er im Panzerzug an die Ostfront fuhr und kurz Halt machte, 80 Jungs aufgereiht zu seinen Ehren, jedem dritten schüttelte er die Hand. „Ich habe denen meine Mamme nicht ausgeliefert. Ich hatte doch nur sie.“ Und sie hatte nur Marian, denn die deutschen Männer waren alle im Krieg, und der Krieg war verloren, und nur wenige kehrten heim.
Am 20. Januar 1945 kam der Befehl, den Ort zu räumen, die Ostgebiete zu verlassen. Die Frauen, Kinder und Alten machten sich auf den Weg, die Knechte gaben nun den Ton an. Marian zögerte, ob er bei seiner deutschen Geliebten bleiben sollte. Ihre Söhne waren nicht seine Söhne, spät, zu spät richtete er das Fuhrwerk zur Flucht. „Bomber dröhnten. Panzer gingen in Flammen auf. Der liebe Gott versteckte sich hinter einer Rauchwolke.“ Ein Geschoss traf den Pferdewagen. Rudolf sprang zur Seite, in den Graben, wie er es in der Hitlerjugend gelernt hatte.
Sie kehrten nach Kurheim zurück. Was dort beim Einmarsch der Russen geschah, daran erinnerte er sich später nicht mehr. Wollte nicht, konnte nicht. Sein persönliches Pech, dass er schon 14 war. Alt genug für die Zwangsarbeit, und so wurde er nach Odessa verschleppt. Arbeit in einem Sägewerk, kein Samstag, kein Sonntag, keine Hoffnung. Aber die Gewissheit, er würde zu seiner Mutter zurückkehren. Deshalb blieb er wachsam. Bis sich die Gelegenheit zur Flucht bot. Einmal war ihm erlaubt worden, sich draußen ein wenig die Beine zu vertreten und schon war er weg, klemmte sich unter einen der Züge, die Richtung Westen rollten. Schlug sich durch als Knecht, nahm den polnischen Vornamen Roman an und fand schließlich Mutter und Brüder wieder.
Er hätte in den Westen gehen können...
Sie blieben in Kurheim, das nun Powidz hieß, aber wieder ohne Mann im Haus, denn Marian war auf und davon. Nun waren sie die Knechte, mussten für die anderen schuften, wurden selbst herumgeschubst, bis seine Mutter die Papiere zur Wiedererlangung der polnischen Staatsbürgerschaft einreichte. Von da an wurde alles besser. Marian kehrte zur Mutter zurück, nun da sie Polin war, und sie zogen dorthin, von wo die Deutschen geflohen waren, nach Barlinek, einst Berlinchen. Das Schönste dort waren die Sonntage, da wurde Kuchen gebacken, da fand die Mutter Zeit, ihm über den Kopf zu streicheln, da gab es ein heißes Bad, einen Spaziergang durchs Neubauviertel, da wurde gesungen, wie früher in der Heimat.
Nun war er 18, arbeitete als Tischler und erinnerte sich an seine Träume, etwas lernen, auf die Hochschule gehen. Sein Polnisch wurde immer besser, die deutschen Zeugnisse hatte er verbrannt, aber er holte schnell alle Prüfungen nach auf der Abendschule. Er hätte in den Westen gehen können, der ältere Bruder hatte sich in der Nähe von Wolfsburg niedergelassen wie viele Steinfelser, schrieb Brief um Brief, bot Hilfe zur Übersiedlung an, aber sie wollten nicht.
Rudolf ging zum Arbeitsdienst, Kriegstrümmer beseitigen. „Komm und kremple die Ärmel hoch“, sang er im Chor, „spuck in die Hände, pack mit an, nimm die Kelle, stell dich auf unsere Seite, sei unser Mann.“ Das dachte auch die Armee, seine Einberufung stand an, und er wusste die Gunst der Stunde zu nutzen, weil er spürte, dass er einer war, der voran gehen konnte. Bei den Pionieren, an vorderster Front. Da brauchte es viel Mut. Beim Minenräumen. Tretminen, die einem das Bein abrissen. Panzerminen, die einen in Stücke zerfetzten. Hitlers Hinterlassenschaft: endlose Minenfelder. Zwei Mann aus seiner Truppe starben. Nur zwei Mann, dank seiner Umsicht. „Wer sucht, der findet. Wer drauftritt, verschwindet.“
Er brachte es sehr weit bei der Armee, Unterleutnant, Leutnant, Hauptmann. Die schönsten Jahre seines Lebens. Parole: „Zum Offizier macht dich nicht Abitur, sondern ehrlicher Wille nur.“ Das Abitur holte er trotzdem nach. Beinah wäre er sogar General geworden. Er sollte nach Moskau geschickt werden, auf die Militärakademie, aber er hatte unterschlagen, dass es da noch den Bruder in der BRD gab, im feindlichen Ausland, den die Mutter endlich einmal besuchen wollte. Als sie den Reiseantrag stellte, flog alles auf. Er nahm seinen Abschied, aber der Geheimdienst klopfte dennoch an seine Tür, sie wollten ihn verpflichten, als Spion, aber dafür war er sich zu schade.
Er hatte ja inzwischen Familie; Frau und Kindern wollte er in die Augen sehen können. Seine Frau Bernarda stammte aus einem kleinen Dorf in Ostpolen, heute Weißrussland. An einem verschneiten Aprilmorgen 1940 wurde sie mit ihrer Familie nach Kasachstan verschleppt und lebte dort in einer Erdhütte, bis der Frieden kam und sie in Polen angesiedelt wurden. Rudolf pfiff gern, und er spielte gern Mundharmonika, ins Herz der Mädchen spielte er sich, ins Herz seiner Frau. Im Alter pfiff er nur noch im Keller, im Haus durfte er nicht mehr pfeifen. Und die Mutter, die spielte ihr Akkordeon nur auf dem Dachboden, durchs Haus sollten die Melodien nicht tönen, das hätte Bernarda zu traurig gestimmt. Denn sie sang wunderschön, sie hätte so gern im Chor gesungen, im berühmten Mazowsze-Ensemble, aber dann kamen die Kinder, die Tochter und der Sohn, und es gab so viel zu tun. Anfangs gingen sie noch gern ins Kino, als er um sie warb, und zum Tanz, in die Bambino-Milchbar, Piroggen essen. Er war ein ordentlicher Esser, blamierte sich niemals vor der Verwandtschaft seiner Frau mit dem Satz: „Nein, danke, ich bin satt.“
Sie mochte Rudolf, aber sie hätte ihn sich im Alter ein wenig lebenslustiger gewünscht. Das Leben hatte ihn hart gemacht, und diese Härte forderte er auch von seinen Kindern. Wer will, kann alles. „Papi, mach, dass es Sonntag ist!, quälten sie ihn, wenn sie montags keine Lust hatten, in den Kindergarten zu trippeln.“ Das konnte er nicht, und Gefühle zeigen, das mochte er nicht, sie wurden nur selten gestreichelt, stattdessen mit Geschichten verwöhnt.
Nach der Verabschiedung vom Militär schrieb er sich an der Fachhochschule für Bauwesen ein, lernte Tag und Nacht, zog nach Szczecin, baute dort Häuser für die Bewohner, immer mit überdurchschnittlicher Normerfüllung. Das lohnte sich. Sie waren die Ersten, die einen Schwarz-Weiß-Fernseher kauften. „Bolek i Lolek“, da kamen alle Nachbarskinder in die kleine Wohnung. Er bekam eine Seereise geschenkt als Auszeichnung für seine vorbildlichen Leistungen als Oberbauleiter, Frau und Kinder blieben daheim. Er brachte eine große, sprechende Puppe mit und viele bunte Postkarten. Als die Wende kam, ging er in den Vorruhestand. Seine Orden galten nichts mehr, aber da stand sein Haus, das er selbst gebaut hatte. Sein Garten, die Rosen an den Pergolen und an den Wänden der Gartenlaube. Einen so schönen Garten, den hatte doch sonst niemand, auch sein Bruder im Westen nicht, auch nicht die Tochter in Berlin, bei der er gelegentlich wohnte. Und noch im hohen Alter kletterte er auf die Bäume, trotz Bluthochdruck und Schmerzen in der Brust. Er chauffierte seine Frau zu den Ärzten und zum Kirchenchor, manchmal auch in die Konditorei, und sie küsste ihm nach jeder Heimfahrt zum Dank die Wange.
Aber da blieb immer ein wenig Wehmut, Wehmut, die herrührte von der Erinnerung an die Welt von damals, Steinfels, eine Welt in einer Nussschale, „vorhersehbar und geborgen trotz aller Gefahren“, Wehmut, die bittersüß schmeckte, wenn Krautwickel aufgetischt wurden. Wehmut, die sich verflüchtigte, wenn ihn die Sonnenblume im Garten grüßte, die Vögel am Fensterbrett pickten, und er stolz auf seine vielen Osterhasen sah, so viel mehr Hasen als damals im Garten daheim.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false